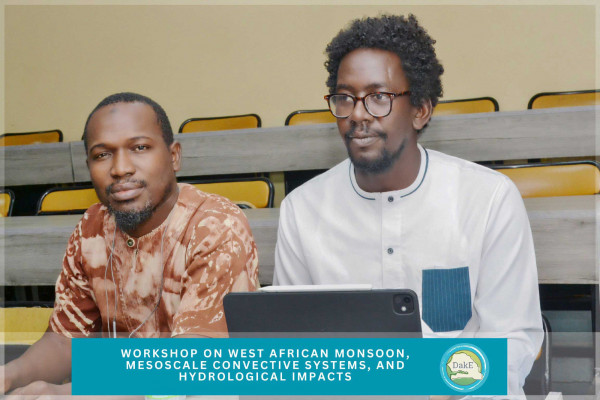Ausbau der Wetterbeobachtung: Neue Messstationen in Schulen südöstlich von Dakar installiert
Forschende der Universität Potsdam, der Universität Cheikh Anta Diop (UCAD) in Dakar und des ZMT haben sich im Juni/Juli 2025 und September 2025 erneut zusammengetan, um das bestehende DakE-Wetterstationsnetzwerk im Senegal zu erweitern. DakE ist eine Feldkampagne zum Thema “High resolution weather observations east of Dakar” , die seit Frühjahr 2023 aktiv ist. Sie wurde am ZMT initiiert und wird seit Juli 2024 vom Europäischen Forschungsrat (ERC) über die Universität Potsdam finanziert.
Der Senegal ist besonders anfällig für Überschwemmungen aufgrund von starken Regenfällen während der Monsunzeit, unzureichenden Entwässerungssystemen in Ballungsräumen und einer schnell wachsenden städtischen Bevölkerung.
„Die Sahelzone ist eine kritische Klimazone an der Schnittstelle zwischen dem feuchten tropischen Golf von Guinea und der trockenen Sahara-Wüste, und die Beobachtung ihrer langfristigen Veränderungen direkt vor Ort ist besonders sinnvoll“, sagt Jan Härter, der das DakE-Projekt leitet. Er fügt hinzu: „Und die Rolle, die die Bodenfeuchte bei der Modulation künftiger Niederschläge spielen kann, ist in dieser Region der Welt einzigartig.“
Während ihrer Feldarbeit installierte das Team fünf zusätzliche Wetterstationen in lokalen Schulen in Sandiara, Joal-Fadiout, Keur Martin, Ndoung und Ndiaganiao – letzteres ist das Heimatdorf des derzeitigen senegalesischen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye.
Das Netzwerk der Wetterstationen deckt nun ein größeres Gebiet südöstlich von Dakar ab, wo in der Regel mehr Niederschläge fallen. Dadurch wird ein größerer Datensatz zu Niederschlägen zur Verfügung stehen, um die Eigenschaften von Gewitterwolkensystemen in dieser Region zu untersuchen.
Das bestehende Netzwerk von zwölf automatischen Wetterstationen wurde nun um fünf hochwertige Campbell-Stationen erweitert, um die bisherige Anlage zu ergänzen. Neben der Aufzeichnung atmosphärischer Variablen (Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag) mit hoher zeitlicher Auflösung messen sie auch Strahlungsvariablen wie die Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche und die von der Atmosphäre oder der Oberfläche empfangene Infrarotstrahlung. Darüber hinaus überwachen sie auch Bodenvariablen wie Bodentemperatur und Feuchtigkeit in verschiedenen Tiefen von 10, 20, 40 und 60 cm.
„Technisch gesehen besteht ein großer Bedarf an Messdaten, worauf unsere senegalesischen Kollegen immer wieder hinweisen“, sagt DakE-Koordinatorin Mai-Britt Berghöfer von der Universität Potsdam. „Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Region ein faszinierender Ort für Studien, da mesoskalige Konvektionssysteme Niederschlagsstrukturen erzeugen, die einer einfacheren Geometrie folgen als in anderen Teilen der Welt.“
Von Satellitenkarten zu Betonfundamenten
Die Einrichtung einer Wetterstation am Boden erfordert Vorbereitungen, die Suche nach einem geeigneten Standort sowie Kenntnisse in den Bereichen IT und Elektronik. Bevor sie sich vor Ort begeben, schließen die Wissenschaftler in Deutschland alle Sensoren vorab an, bereiten die Software vor, mit der die Daten automatisch verarbeitet werden sollen, und testen die Konnektivität.
Mithilfe von Satellitenkarten identifizieren die Forscher dann potenzielle Standorte. „Idealerweise benötigen wir ein offenes Feld ohne Hindernisse durch Gebäude oder Vegetation, damit die Wind- und anderen atmosphärischen Messungen gemäß den offiziellen Richtlinien der Weltorganisation für Meteorologie durchgeführt werden können“, erklärt Maxime Colin, Mitarbeiter des Projekts aus dem Programmbereich 2 „Global Change“ des ZMT und Koordinator der Feldarbeit im Juni und Juli. „Anschließend müssen wir die Genehmigung einholen, um die Wetterstationen an diesen geeigneten Standorten zu installieren“, berichtet Colin.
Once permission is granted the digging starts. “We dig holes in the ground for the main pole on which the weather station is set up. Another hole is dug for the rain gauge and then we need to go even deeper to install the soil sensors at 10, 20, 40 and 60 cm depth,” says Dame Gueye from the University Cheikh Anta Diop.
Finally, the teams set up another 12 poles for the fence to protect the station. All holes will then be filled with concrete to anchor the poles firmly in the ground.
“Only now can we start to set up all the sensors one by one at their location on the pole,” says Yahaya Bashiru from University of Potsdam and ZMT. “ We then have to correctly connect all 50 electric cables in the data logger which collects the information and sends it with a SIM card to the internet. Setting up the software to correctly submit the data was also not an easy task” adds Diana Monroy, from the University of Potsdam.
“After getting permission, setting up a weather station like this can take two days with up to eight people working hard under the sun,” adds Didier Gati-Mounga from UCAD.
Wenn der Staub aufwirbelt: Das Wetterphänomen „Haboob“
Während dieser Reise konnten die Forschenden einen intensiven Staubsturm beobachten, der als „Haboob“ bezeichnet wird – Staub, der durch turbulente Winde aufgewirbelt wird und sich kurz vor dem Eintreffen einer Gewitterfront schnell ausbreitet.
„Ein Haboob ist eine Auswirkung von Kaltluftbecken, die sich auf trockenem, staubigem Boden ausbreiten, und eines der Hauptphänomene, die wir mit den DakE-Daten untersuchen wollen“, erklärt Maxime Colin.
„Kaltluftbecken sind kalte Luftmassen in Bodennähe, die durch die Verdunstung von Regen während Gewittern entstehen. Sie sind ein Schlüsselelement, um zu verstehen, wie sich ein Sturm in Raum und Zeit bewegt. Für mich war dies das erste kalte Luftpolster, das ich in Afrika gesehen habe, was etwas ganz Besonderes war.“
„Wir müssen nun darüber nachdenken, wie wir das Netzwerk langfristig aufrechterhalten können“, sagt Jan Härter. „Deshalb suchen wir derzeit nach neuen Finanzierungsquellen, um die notwendigen Wartungsarbeiten durchführen, Teile ersetzen und unsere senegalesischen Kolleg:innen weiterhin in das Projekt einbinden zu können.
And the digging starts to set up the weather station in Sandiara (with, from left to right, two local helpers from Sandiara, Dame Gueye, Yahaya Bashiru, Dioumacor Faye, Didier Gati-Mounga) | Photo: Maxime Colin, ZMT
Internationaler Workshop an der UCAD
Die Erweiterung der Wetterstationen im Juli wurde durch einen internationalen Workshop zum Thema „Westafrikanischer Monsun, mesoskalige konvektive Systeme und hydrologische Auswirkungen“ mit Forschenden und Interessengruppen ergänzt, der vom 10. bis 14. September 2025 an der UCAD in Dakar stattfand. Er brachte etwa 50 Wissenschaftler:innen und Interessenvertreter:innen aus verschiedenen afrikanischen Ländern und darüber hinaus zusammen. Dieser Workshop kann dazu beitragen, den künftigen akademischen Austausch zwischen Subsahara-Afrika und Deutschland zu fördern.
Der Workshop wurde vom DakE-Team organisiert und umfasste wissenschaftliche Vorträge und einen Tag mit Outreach-Aktivitäten, an denen Schüler und Lehrer aus vielen der am DakE-Projekt beteiligten Schulen teilnehmen konnten, um mehr über die wissenschaftlichen Ziele des Projekts zu erfahren. Die Outreach-Aktivitäten fanden an der École Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA) in Thiès statt, einem der kooperierenden Institute innerhalb von DakE. Während dieser Outreach-Veranstaltung sprachen die Organisatoren mit Schulkindern und ihren Lehrer:innen über die Wetterstation, die sie in ihren Schulen haben, über den Klimawandel und die Klimawissenschaft im Allgemeinen.
Die Veranstaltung wurde unter der Leitung von Prof. Jan Härter (Universität Potsdam) und Prof. Amadou Gaye (UCAD) organisiert und dank des Einsatzes von Mai-Britt Berghöfer (Universität Potsdam), Diana Monroy (Universität Potsdam) und Dame Gueye (UCAD) durchgeführt.
International workshop “West African monsoon, mesoscale convective systems and hydrological impacts“ with scientists and stakeholders, which was held at UCAD, Dakar, during the period of Sept 10 - 14, 2025 | Photo: DakE project, University of Potsdam
Über das DakE-Projekt:
Das DakE-Projekt an der Universität Potsdam hat zum Ziel, östlich von Dakar ein hochauflösendes Beobachtungsnetzwerk aufzubauen, um mesoskalige konvektive Systeme nahezu in Echtzeit zu beobachten. Die gesammelten Daten sollen dazu beitragen, das Verständnis der Entstehung und des Zerfalls mesoskaliger konvektiver Systeme zu verbessern und das Risiko extremer Gewitterereignisse zu bewerten. Das Projekt wird vom Proof-of-Concept-Programm des Europäischen Forschungsrats (ERC) finanziert.